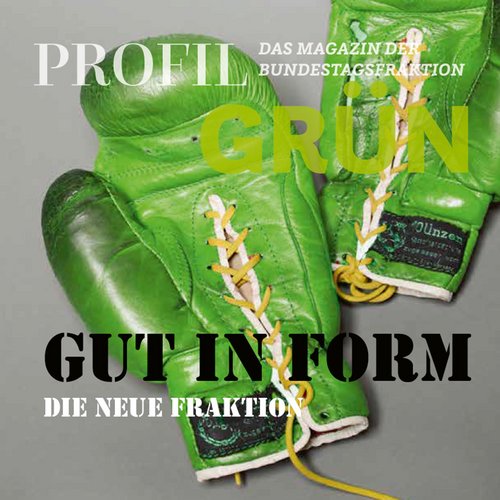Veröffentlicht am
Bevölkerungsschutz nachhaltig stärken
- Drei Jahre nach der Katastrophe im Ahrtal steht der Bevölkerungsschutz neuen Problemen gegenüber — die fortschreitende Klimakrise und der russische Angriffskrieg stellen neue Herausforderungen an das System.
- Gerade Kommunikation und Koordination zwischen Bund und Ländern funktionieren im Ernstfall noch nicht optimal.
- Für einen schlagkräftigen Bevölkerungsschutz müssen bestehende Strukturen wie das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz (GeKoB) reformiert und über weitere Möglichkeiten der Koordinierung diskutiert werden.
Der Klimawandel hat auch in Deutschland bereits zu immer mehr und immer stärkeren Extremwetter-Ereignissen geführt. Uns werden in Zukunft weiterhin Fluten, extreme Hitze oder Waldbrände begegnen. Zur Bewältigung derartiger Ereignisse müssen angemessene Maßnahmen ergriffen werden.
Schutz vor Natur- und anderen Ereignissen
Einerseits müssen weitere Maßnahmen zum Schutz des Klimas getroffen werden. Andererseits müssen alle Lebensbereiche an die sich verändernden Klimabedingungen angepasst werden (Klimafolgenanpassung). Die Resilienz der Bundesrepublik und die Sicherheit der Menschen kann nur dann hinreichend verbessert werden, wenn beides Hand in Hand angegangen wird. Dafür setzen wir uns als grüne Bundestagsfraktion mit aller Kraft ein, so ist im Juni 2024 das Klimaanpassungsgesetz inkraft getreten.
Wir wollen in dieser Legislaturperiode ein ambitioniertes Hochwasserschutzgesetz auf den Weg bringen. Es soll die Ausweisung von Baugebieten innerhalb von Überschwemmungsgebieten verhindern, die Risikovorsorge und den Bevölkerungsschutz vor Ort entscheidend verbessern. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren zum Hochwasserschutz werden wir beschleunigen.
Gleichzeitig rückt mit Blick auf den völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und mit Blick auf Sabotagen, wie an der Nord-Stream-2-Pipeline, auch die Notwendigkeit eines besseren Schutzes der Bevölkerung im Falle eines Angriffs stärker in den Fokus. In beiden Bereichen, also dem Schutz vor Naturereignissen und dem Schutz vor Angriffen, stellen sich ähnliche Probleme.
Effektive Warnungen und Koordinierung im Ernstfall
Mit der Einführung des Cellbroadcasts, einem Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf Handys oder Smartphones geschickt werden können, ist im Winter 2022 ein maßgeblicher Erfolg gelungen. Mit einer funktionierenden Warnung hätten bei der Katastrophe im Ahrtal nachweislich Menschenleben gerettet werden können. Die Auswertung des Warntags 2024 durch das BBK zeigt: Mit dem „Warnmix“, einer Kombination verschiedener Warnmittel (wie etwa Fernsehen, Radio, Smartphones, Infotafeln, Lautsprecher) wurden 95 Prozent der befragten Menschen erreicht. Damit gehören wir nun zu den Spitzenreitern in Europa. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bevölkerung künftig noch besser gewarnt werden kann, etwa mit einer verbesserten Warnung mit Sirenen. Im Falle der Hochwasser in Süddeutschland im Mai und Juni dieses Jahres haben die Warnungen gut funktioniert. Dennoch ist der Ausbau von Sirenen bundesweit vonnöten, insbesondere Sirenen, die für einen so genannten „Weckeffekt" sorgen können.
Am Beispiel der gravierenden Waldbrände wird ein Problem des Deutschen Bevölkerungsschutzes offensichtlich: Die Strukturen sind oftmals nicht ausreichend miteinander vernetzt, sodass schnelle und effektive Hilfe aus benachbarten Regionen oder benötigte spezielle Einheiten nicht rechtzeitig vor Ort sein können. Bisher fehlt es an einer schlagkräftigen Koordinierungsstelle, die Einheiten von Bund und Ländern im Ernstfall steuert.
Das als Reaktion auf die Katastrophe im Ahrtal geschaffene Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz (GeKoB) ist grundsätzlich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mit den entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet, kann es die notwendige Koordinierungsarbeit leisten, zum Beispiel durch ein Ressourcenregister oder ein digitalisiertes 360-Grad-Lagebilds. Es bedarf jedoch weitergehender Reformbemühungen, um im Ernstfall schnell und effizient reagieren zu können. Im Falle einer neuen Katastrophe ist das GeKoB bisher noch nicht voll einsatzbereit. Wir setzen uns dafür ein, dass das GeKoB zügig mit Kompetenzen, Ressourcen und Fachpersonal besetzt wird und so ein Höchstmaß an Expertise und eine effiziente Koordinierung gewährleistet wird.
Gleichstellung von Helfer*innen
Wir als grüne Bundestagsfraktion setzen uns außerdem mit Nachdruck für bessere Rahmenbedingungen für freiwillige Helfer*innen im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ein. Wir wollen die Gleichstellung der ehrenamtlichen Helfenden der anerkannten Hilfsorganisationen mit den Einsatzkräften von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr erreichen. Dabei geht es um die erforderliche Freistellung von den Verpflichtungen am Arbeitsplatz durch Arbeitgeber*innen, Schadensersatzansprüche und um die soziale Absicherung.
Weitere Meldungen zum Thema
Die Rente reicht oft nicht, Arzttermine sind Mangelware und gute Pflege ist extrem teuer geworden. Wir schlagen deshalb ein „Sofortprogramm Zukunft“ vor, um unseren Sozialstaat endlich gerechter, digitaler und fit für morgen zu machen.
Wir haben ein massives Gewaltproblem in unserer Gesellschaft und Frauen sind davon besonders stark betroffen.
Zugausfälle wegen Angriffen auf Bahngleise oder ein lahmgelegtes Bürgeramt. Fast täglich gibt es digitale und physische Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur. Wir brauchen einheitliche Schutzstandards um resilienter zu werden.
Wir tragen Verantwortung. Es darf kein Vergessen geben. Das Gedenken an die Verbrechen der Nationalsozialist*innen ist eine bleibende und immerwährende Aufgabe.
Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts zeigen erneut die immanente Bedrohung durch Spionage für unsere Sicherheit.